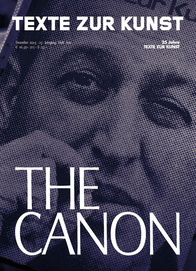
Texte zur Kunst - Heft 100 (Dezember 2015)
availability unknown, if interested please write an email
Wenn Texte zur Kunst anlässlich ihres Jubiläums den „Kanon“ zum Thema macht, dann liegt dem auch ein selbstreflexiver Impuls zugrunde: Die Zeitschrift gehört inzwischen selbst zu den Institutionen der Kanonbildung. In ihrer 25-jährigen Geschichte hat sie nicht nur bestimmte Methoden der Kritik forciert, sondern auch entscheidend zur Durchsetzung zahlreicher Künstler/innen beigetragen.
In der 100. Ausgabe die eigene Praxis mit der Perspektive auf die Kanonbildung zu diskutieren, heißt, dem Umstand Rechnung zu tragen, dass Kritik sich nicht nur in der Zurückweisung des jeweils Hegemonialen manifestiert, sondern auch in positiven Stellungnahmen. Wir haben deshalb langjährige Autoren/Autorinnen, Künstler/innen sowie Kritiker/innen der jüngeren Generation darum gebeten, sich zu einer oder zu mehreren künstlerischen Praktiken nach 1990 – dem Gründungsjahr dieser Zeitschrift – zu bekennen und dabei die Gründe für ihre Wahl ebenso offenzulegen wie die ihr zugrunde liegenden methodischen Prämissen. Was spricht heute für eine bestimmte Praxis, und warum erachte ich sie für maßgeblich, wenn es darum geht, im unübersichtlichen Feld der Gegenwartskunst Orientierung zu schaffen?Wir verstehen den Kanon dabei als Schauplatz eines lebendigen kunstkritischen Streits. Damit widersprechen wir offenkundig der konservativen Kanonvorstellung, die nicht nur naturalisierend und autoritär, sondern auch verkürzend ist, weil sie aus der Gegebenheit eines Traditionszusammenhangs dessen verpflichtenden Charakter ableitet. Der Kanon ist indes nicht einfach identisch mit dem Überlieferungszusammenhang der Tradition: In Letzteren sind wir hineingestellt, und zwar auf eine Weise, die unsere Orientierungen mit prägt. Der Kanon hingegen ist mit jeweils aktuellen Werturteilen unterlegt; er steht mithin für die aktive, die kritische Beziehung zur Tradition. Zwar kann sich die Position der Kritik selbst nie gänzlich von der Tradition freimachen, gegen die sie sich wendet. Dennoch ist es möglich, Aspekte ihres jeweils hegemonialen Verständnisses zu verschieben, Narrative und Kriterien infrage zu stellen, die es stützen, oder Voraussetzungen der in ihm angerufenen kulturellen Gemeinschaft zurückzuweisen. Sofern also „Kanon“ der Name für die Dynamik zwischen Kritik und Überlieferungszusammenhang ist, ist er seinem Wesen nach umstritten. Wie die auch in dieser Zeitschrift stark gemachte feministische und postkoloniale Kanonkritik besonders pointiert gezeigt hat, geht es in den Auseinandersetzungen um den Kanon keineswegs nur um die Vergangenheit; vielmehr geht es zugleich um einen Begriff der Gegenwart, der sich aus dem Verständnis der Vergangenheit entwickelt, und dies in einer Weise, die die Gegenwart auf eine bestimmte Zukunft hin ausrichtet. Das verbindet den normativen Diskurs um den Kanon mit dem um den Fortschritt und die Kunstkritik mit der Politik.Bezüge auf den Kanon können deshalb auch dort, wo es um das jeweilige Verständnis von Kunstgeschichte geht, nie neutral sein. Sie müssen als argumentative Einsätze verstanden werden, als Züge in einem Feld der Auseinandersetzung, in der es auch um das Interesse an der Durchsetzung des als kanonisch Behaupteten geht. Mit dem Streit um den Kanon ist folglich immer auch der Anspruch auf Allgemeinheit verbunden. Ob aber eine Kanonrevision in dem Sinne erfolgreich ist, dass sich die von ihr vorgenommene Neuperspektivierung der Tradition tatsächlich durchsetzt, kann nicht allein von denjenigen kontrolliert werden, die für sie eintreten. Ihr Erfolg oder Misserfolg kann sich vielmehr selbst nur historisch zeigen, in einem intersubjektiven Prozess des Austauschs von Gründen, der auch dort, wo er sich konsensuell beruhigt, mit neuerlichen Einsprüchen rechnen muss. „Kanon“ ist also auch der Name für eine Dynamik zwischen Besonderem und Allgemeinem, zwischen Ich und Wir.In diese Dynamik sind eben auch kanonbildende Prozesse einbezogen, bei denen es darum geht, Gegenwärtiges als kanonfähig zu behaupten. Es geht bei diesen Behauptungen, wie sich auch in den Beiträgen des Hefts zeigt, jedoch nicht in erster Linie um eine Wette auf die Zukunft, darauf also, dass die gutgeheißenen Positionen den Test der Zeit bestehen und weitere Anerkennung finden werden. Vielmehr geht es in einem ersten Schritt darum, die Kriterien des Kanonischen selbst durch die aktuelle Einschreibung zu entfalten: Was wird kanonisiert und warum? Dabei können etablierte Kriterien bestätigt, fortentwickelt, kritisch verschoben oder durch andere ersetzt werden. An der Kanondiskussion lässt sich damit konzentriert beobachten, was mal mehr, mal weniger explizit für jede Kunstkritik gilt, also auch für diejenige, die sich nicht explizit auf das Kanonproblem bezieht. Künstlerische Positionen als Kunst zu verteidigen, die sich etwa gegen den männlichen Künstlermythos oder gegen die Zentralstellung der Medienspezifik im modernistischen Diskurs, gegen die Ausblendung der Produktionsverhältnisse in der bürgerlichen Kunstideologie oder gegen die alleinige Orientierung des Kunstdiskurses am Westen wenden – um nur einige Motive zu nennen, die in der Geschichte dieser Zeitschrift eine wichtige Rolle gespielt haben –, heißt nichts anderes, als die Kriterien der Wertbildung zu verändern, und zwar in einer Weise, die auch das Verhältnis zur Vergangenheit betrifft. Von den aktuellen Setzungen her eröffnen sich, zumindest potenziell, andere Genealogien, andere Hierarchien, andere Wertvorstellungen und Einschlüsse. Das bislang Marginalisierte kann dabei ebenso in den Blick treten wie neue Aspekte des scheinbar Etablierten.Es geht mit der vorliegenden Kanon-Nummer also keineswegs um eine Geste des Abschlusses; vielmehr darum, ein normatives Feld sicht- und diskutierbar zu machen, das sich um eine konkrete Institution, die Institution dieser Zeitschrift, formiert hat. Dabei wird einerseits eine Binnendifferenzierung deutlich: Texte zur Kunst ist von Anfang an getragen von unterschiedlichen kritischen Einsätzen und durchzogen von verschiedenen, keineswegs immer miteinander kompatiblen Argumentationssträngen. Andererseits zeigt sich auch der gemeinsame Boden, auf dem diese Differenzen erscheinen können: Zu nennen wären hier nicht nur geteilte Grundüberzeugungen, theoretische oder künstlerische Bezugsgrößen, sondern auch ein bestimmtes, durch Freundschaften, aber auch durch Institutionen (Galerien, Kunstvereine, Museen, Kunsthochschulen, Universitäten) geprägtes soziales Milieu. Dieses Milieu ist Produkt kritischer Arbeit ebenso wie Effekt von Kontingenzen. In einigen Beiträgen wird zu Recht die Ein- und Ausschlussbewegung des Kanons reflektiert, also darüber nachgedacht, warum bestimmte Aspekte, auch im Horizont dieser Zeitschrift, außen vor bleiben und andere für relevant erklärt werden.Solche kritische Selbstbefragung ist dabei Teil des Rechtfertigungszusammenhangs, in den wir die Kanondiskussion, die Diskussion unserer eigenen Praxis, explizit stellen wollen – dass der Anspruch auf die Dimension der Allgemeinheit, die der Begriff „Kanon“ impliziert, stets zurückgebunden bleibt an je spezifische Situiertheiten, deren Geltungsanspruch keine andere Grundlage haben kann als eben diese: dass er sich argumentativ exponiert und der Möglichkeit des Gegenarguments aussetzt. Nicht zuletzt im Horizont einer im Dienste des Ökonomischen stehenden Kultur generalisierter „Likes“ erscheint es uns notwendig, auf der Bedeutung der argumentativen und normativen Auseinandersetzung selbst zu insistieren.Diese Ausgabe ist daher vor allem dies: eine Aufforderung zur Fortsetzung des kunstkritischen Streits. (Editorial) Sprache: Deutsch/Englisch

































