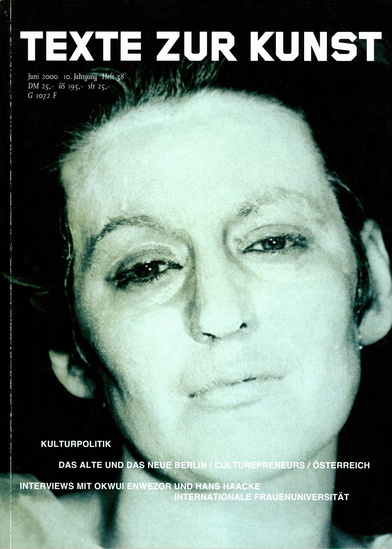
Magazine, German, Glue Binding, 224 Pages, 2000
Texte zur Kunst - Heft 38 (Juni 2000)
availability unknown, if interested please write an email
Inzwischen steht „Kulturpolitik" längst nicht mehr nur für die Verteilung von Mitteln für Kunst, Bildung und Wissenschaft, Förderung durch den Staat oder andere Institutionen. Es hat eine extreme Ausweitung ihres Bedeutungsfeldes stattgefunden, was KulturpessimistInnen immer wieder mit einer Aufweichung des Begriffs „Kultur" zu erklären versuchen.
Realistischer dürfte die Beobachtung sein, dass sich der Wortteil „Kultur" in der aktuellen Verwendung attributiv zu „Politik" verhält, im Sinne von „kulturzentrierter Politik" oder „Kultur als Politik". „Kulturpolitik" in dieser Lesart kann auch als ein zentraler Begriff für einen Neuheitsanspruch der bundesdeutschen Regierungspolitik nach 1998 stehen. Die Gefahren der Überbewertung eines kaum definierten Kulturbegriffs, eines entpolitisierten Kulturalismus liegen auf der Hand. Er taugt auch nicht, um aktuelle Kulturproduktionen in ihren spezifischen Kontexten und Interessenlagen zu erfassen. Deshalb sind es keine monolithischen Fragen an das Thema, die uns in dieser Ausgabe interessieren. Die Textbeiträge beziehen sich im Wesentlichen auf drei Bereiche: auf den extremen öffentlichen und privaten Repräsentationsschub in der Bundesrepublik, zu dem der Umzug der Regierung nach Berlin und Renationalisierungsdiskurse gehören; auf die möglichen Einflüsse Internationaler Großausstellungen auf die Herausbildung neuer Produzent/innen-Typen; und schließlich auf die komplexen Auswirkungen, die die Beteiligung von Rechtsextremen an der österreichischen Regierung auf Kulturförderungsstrukturen haben könnte. Welche Rollen übernehmen Kunst- und Kulturproduzent/innen in disen politischen Umstrukturierungsprozessen?Bis vor einigen Jahren war Kulturpolitik im Sinne staatlicher Politik in der Bundesrepublik immer eine Sache der Länder und Kommunen. Nicht erst seit dem Regierungswechsel von 1998 und dem Umzug der Regierung nach Berlin lassen sich Versuche einer staatlichen „Re-Formation" aufgegebener Repräsentationsposten beobachten. Zum ersten Mal in der Geschichte des Bundestags gibt es nun einen Bundeskulturausschuss — und als das „Gesicht" dieser neuen Kulturpolitik einen Staatsminister für Kultur, der seinen Sitz im Kanzleramt bezogen hat. Michael Naumann gerät in seinem neu designten Amt als „Bundeskulturbeauftragter", das von Anfang an als Zeichen antiföderativer Tendenzen kritisiert wurde, immer wieder In Konflikte: zwischen seiner unklaren Funktion als staatlicher Repräsentant für „Kultur" und internationalen, nationalen, föderalen und kommunalen Interessen. Naumann muss sich die Frage stellen, wie eine Rückbindung von „Kultur" an einen Staat zu bewerkstelligen sein könnte, der an allen Ecken und Enden seine zu nehmende privatwirtschaftliche Abhängigkeit offenbart. „Demokratische, föderale Kultur" ist insofern nicht mehr als Gegensatz zu privatwirtschaftlich organisierter und finanzierter Kultur zu sehen — zumindest in Westeuropa eine Denkübung, mit der sich Kulturinstitutionen und -produzent/innen auseinander zu setzen haben. Dass auch und gerade staatliche Initiativen Agenten von Kulturpolitik sein können, ist zwar längst so bekannt Wie die Idee, dass „Mischfinanzierungen" aus öffentlichen Geldern und Drittmitteln ein Abbild privatökonomischer Anlehnungsbedürfmsse des Staates liefern. Nur bleibt dabei die Verteilung der inhaltlichen und organisatorischen Anteile unklar. Nach 1989 hat sich nicht nur in Deutschland ein verschärftes Konkurrenzverhältnis zwischen privaten und staatlichen Investoren herausgebildet, das einen — auch International geführten — Wettbewerb um kulturelle Repräsentativität unmittelbar nach sich gezogen hat. Der Ort, an dem sich diese Konkurrenz zwischen „public" und „private" , aber auch zwischen „zentralen" und „dezentralen" Entwürfen erwartungsgemäß am deutlichsten und repräsentativsten abbildet, ist die „Neue Mitte" Berlin (Harald Fricke). In der komplexen Dialektik staatlicher und ökonomischer Interessen werden Auseinandersetzungen wie die um ein zentrales Holocaust-Mahnmal in Berlin mit ebenso wenig öffentlich-demokratischer Beteiligung geführt wie die Verhandlungen um eine „Entschädigung" von Zwangsarbeiter/innen unter dem NS-Regime. In solchen Symbolisierungsfragen tritt der Unterschied zwischen demokratischer Repräsentanz und der Repräsentation emer Demokratie sehr deutlich zutage. Auf einer kunstpolitischen Ebene hat die Auseinandersetzung um Hans Haackes Entwurf für die künstlerische Gestaltung des Reichstagsgebäudes (Faxinterview mit Astrid Wege) diese Diskussion auf die Spitze getrieben.In anderen, nicht mehr an kritischen Umrissen künstlerischer Produktion festhaltenden Kontexten haben sich neue Kulturvermittlungstypen herausgebildet. die sich vielleicht am besten mit Wechselfiguren wie der des International agierenden „Culturepreneur" umschreiben lassen (Anthony Davies/ Simon Ford). Auch am Beispiel der Manifesta lässt sich zeigen, auf welche begrifflichen Simplifikationen und verkürzenden Metaphern sich Künstlervermittler/innen im „vereinten Europa" inzwischen einlassen: Unter dem Titel „Borderline Syndrome — Energies of Defence" wird die Manifesta in diesem Jahr ihre dritte Folge in Ljubljana veranstalten, einem Ort, den sie in ihrer Werbung wie eine Zugbrücke zur „Festung Europa" behandelt (Gregor Podnar). Großausstellungen wie diese haben die Tendenz, Künstler/innen zu nationalen Kulturbotschafter/innen zu machen. Müssten sich europäische Biennalen nicht in die Pflicht genommen fühlen, einer derartigen nationalen oder eurozentrischen Sichtweise entgegenzuarbeiten? Möglicherweise wird die nächste Documenta (2002) unter dem Eindruck postkolonialer Diskurse mit der von ihrem künstlerischen Leiter Okwui Enwezor propagierten Wechselfigur des „Trickster" ein Gegenmodell zwischen Widerstand und Übersetzung aufbauen können (Interview mit Okwui Enwezor). Welche Differenzierungen müsste eine Kritik des globalen Ausstellungsbetriebs vornehmen, wenn dieser auch nichtwesdichen Orten eine Teilnahme an internationalen Diskursen ermöglicht? Auf bildungspolitischer Ebene entspricht dem die Forderung, nichtwestliche feministische Diskurse in eine internationale Diskussion einzubeziehen. Für Feminismusund Postkolonialismus-Debatten stellt derzeit die Internationale Frauen-Universität (ifu) ein wichtiges Projekt dar, dessen Einbindung in den Rahmen der EXPO 2000 wiederum Fragen nach der Repräsentation migrantischer Positionen aufwirft (ifu/EXPO-Diskussion mit Vathsala Aithal, Parwaneh Bokah, Beate Gonitzki, Encarnación Gutiérrez Rodríguez, Katharina Pühl).Wie sehr Kulturpolitik staatlich-parteipolitisch gebunden bleibt, zeigt sich in aller Deutlichkeit sei dem Amtsantritt der neuen österreichischen Regierung unter rechtsextremer Beteiligung. Neben „Fremdenfeindlichkeit“ gilt eine Feindlichkeit aktueller Kunstpraktiken gegenüber als eines der herausstechenden Merkmale nationalistischer Kulturideologie. Angesichts der Regierungspläne, die von neoliberalen Kürzungsprogrammen über eine Stärkung der „Kreativindustrie“ bis hin zu Pfelge von „Volkskunst“ und „nationalem Kulturerbe“ reichen, ist es eine nach rechts abgedriftete öffentliche Meinung, die unter anderem eine Beeinträchtigung der Arbeitsbedingungen und der Freiräume von Künstler/innen und Intellektuellen befürchten lässt (Christian Höller, Christian Kravagna). Interessant im Zusammenhang mit der Frage nach der rolle von Kulturproduzent/innen ist auch das österreichische Modell der Staatskurator/inne, das dafür Sorge tragen soll, österreichischer Kunst internationales Renommee zu verschaffen. Künstler/innen, Intellektuelle und andere Akteur/innen stehen nun dagegen vor dem Problem, sich aus ihrer unmittelbaren wirtschaftlichen Abhängigkeit von einem Staat zu lösen, der sich unter der FPÖ/ÖVP-Regierung den Luxus einer künstlerischen „Elite“ ohnehin nicht mehr leisten will. (Editorial) Sprache: Deutsch/Englisch































