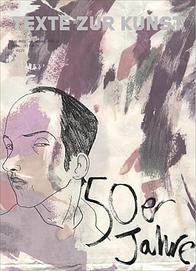
Texte zur Kunst - Heft 50 (Juni 2003)
availability unknown, if interested please write an email
Dekaden sind niemals abgeschlossen, und für die fünfziger Jahre, die wir anlässlich unserer so. Ausgabe behandeln, scheint das in besonderer Weise zu gelten.
Gab es schon für die sechziger Jahre unüberwindlich scheinende Klischeevorstellungen — Polkes „Sekt für alle" fällt einem ein —, die den Zeichnungen von Sigmar Polke als thematisches und stilistisches Mittel der abgrenzenden Ironisierung dienten, so haben zu Beginn der achtziger Jahre Künstler wie Albert Oehlen oder Martin Kippenberger die fünfziger Jahre in einem weiteren Durchlauf vor allem habituell, aber auch künstlerisch wieder aufleben lassen: ikonografisch in Serien wie Kippenbergers „Familie Hunger — aber genauso mit einem Auftreten, das die gepanzerten, disziplinierten Körper und autoritären Stimmen der westdeutschen Nachkriegszeit fortschrieb. Aus produktionsästhetischer Perspektive reichen die fünfziger Jahre also durchaus in die Gegenwartskunst hinein — entweder als Pathosformel, wie zum Beispiel in Polkes Bild „Moderne Kunst", oder als anzueignendes Schema wie in Kippenbergers Ausstellung „Miete, Strom, Gas".Gleichwohl herrscht in der künstlerischen und kunstkritischen Auseinandersetzung mit den Fünfzigern seit langem eine symptomatische Leere vor, die auf einer allgemeinen Überzeugung zu beruhen scheint, diese Zeit sei künstlerisch uninteressant, es lohne sich mithin nicht, sich mit ihr zu beschäftigen. Ambitionierte Ausstellungs- oder Forschungsprojekte, die bei dieser Leere ansetzen, waren und sind dementsprechend eine Seltenheit. In den kuratorischen Moden hoch im Kurs standen vielmehr die sechziger, siebziger und zuletzt natürlich die achtziger Jahre, die bis in den letzten Winkel hinein ausgeleuchtet und unablässig aktualisiert wurden. Indes häufen sich derzeit die Anzeichen dafür, dass die fünfziger Jahre beziehungsweise eine bestimmte Idee von ihnen, unter uns weilen. Der bereits angesprochene, Autorität beanpruchende Habitus hat sich im Kunstbetrieb besonders gut und über lange Zeiträume hinweg gehalten — insbesondere auf Messen oder Galerieeröffnungen lässt er sich punktuell studieren.Aber mindestens ebenso deutlich ist bei aktuellen malerischen Ansätzen wieder viel vom „Menschen" oder von „Wesen" die Rede, in einem Gestus, der aus einer gewissen Diskursmüdigkeit heraus den Eindruck erweckt, man wolle einmal mehr zurück zu den Ursprüngen, den Grundlagen, zu den „eigentlichen Fragen". Dies kann man genauer auch als Ausdruck eines Überdrusses speziell an gesellschaftspolitischen Ansätzen oder soziologischen Kategorien in der künstlerischen Produktion lesen: Statt nach der spezifischen gesellschaftlichen Platzierung eines Individuums in einer hierarchisierten Gesellschaft zu fragen, zieht man sich auf eine allgemeine Feststellung zurück, auf einen weitgehend von historischem Ballast befreiten Humanismus, der suggeriert, dass wir am Ende doch alle nur Menschen sind. So nachvollziehbar dem einen oder der anderen diese Sehnsucht nach Rehumanisierung und „Grundsätzlichem" zum Teil auch erscheinen mag, so ist ein solcher „Resthumanismus" , der auf merkwürdige Weise mit dem Agamben'schen Konzept des „nackten Lebens" koinzidiert, doch stets mit einer entweder ausdrücklichen oder latent bleibenden Verwerfung politischer Kategorien und soziologischer Perspektiven verbunden — ein Preis, den man erst einmal zu zahlen bereit sein muss. Als banalstes populäres Symptom für diese Entwicklung könnte man auf den Erfolg von Herbert Grönemeyers „Mensch"-Album verweisen — ein Album, das schon dem Namen nach „Menschliches" verhandeln will und individuelle Trauerarbeit auf schwer erträgliche Weise mit Exhibitionismus verwechselt.Was jedoch unterscheidet den Rekurs auf „Mensch" heute etwa von dem „Modern Man Discourse" (Michael Leja [1]) der vierziger und fünfziger Jahre? Nicht die Erforschung der „Natur des Menschen", seiner so schwer kontrollierbaren Triebe steht dieses Mal auf dem Spiel — eine Fragestellung, mit der man der konkreten Faschismus-Erfahrung und dem Holocaust begegnete, indem man sie auf eine allgemeine Ebene verschob und ihnen letztlich auswich. Die Funktion von „Mensch" scheint heute eine andere zu sein — es handelt sich eher um eine Chiffre für das allgemein wiedererwachte Interesse an existenziellen und grundlegenden Fragen, Fragen, die eben für alle gelten sollen. Wer sich heute auf „Mensch" beruft, stellt gewissermaßen die nach wie vor fragwürdige Behauptung eines allgemein-verbindlichen Erfahrungshorizonts auf. Doch während der „Modern Man Discourse" Michael Leja zufolge ausschließend funktionierte, weil mit Mensch automatisch „Mann" gemeint war (was die Künstlerinnen des abstrakten Expressionismus, so wäre kritisch anzumerken, keineswegs davon abhielt, sich in diesem Diskurs wiederzufinden), kann heute von einer solchen Eingrenzung nicht mehr ausgegangen werden. Das Problem an der Kategorie „Mensch" ist also nicht in erster Linie darin zu sehen, dass partikulare Identitäten aus ihr herausfallen. Denn warum sollte es nicht möglich sein, diese Kategorie zu öffnen, für sich in Anspruch zu nehmen, zu resignifizieren? Wenn es ein Problem gibt, dann eher die bereits erwähnte, der Kategorie Mensch eingeschriebene anthropozentrische Perspektive. Andererseits muss es uns natürlich zu denken geben, dass es vornehmlich männliche Künstler sind, die diese Kategorie oder wahlweise „Wesen" und „Gestalten" in ihren Bildtiteln aufrufen, sie mit gemalten Figuren oder Objekten evozieren oder in Katalogtexten in Umlauf bringen. Andere Maler — etwa Sergej Jensen oder Stefan Müller knüpfen mit ihrer Semantik unmittelbar an die Bildsprache und das Potenzial der staubigen, muffigen Leinwände aus den fünfziger Jahren an, um sie auf neue Weise zu aktualisieren und ihnen malerische Gesten abzuringen. Ein Künstler wie André Butzer scheint die regressive Programmatik eines Karel Appel oder eines Jean Dubuffet einer erneuten Prüfung zu unterziehen, allerdings unter Verzicht auf jegliche Suggestion von „authentischem Ausdruck". Das aus dem aktuellen „Raum des Möglichen" (Bourdieu) Verbannte wird in demselben Maße angezapft, als es den Effekt der „Zumutung" zu produzieren vermag. Und tatsächlich überfallen einen diese Bilder durch ein „Zuviel" an Farbe, durch ihre penetranten Figuren, durch ein „Zuviel an Anwesenheit" (JeanFrançois Lyotard). Man könnte sagen, dass Butzers Bilder den Blick genau auf jene „Materialität" lenken, auf die sich der Kritiker Clement Greenberg in den späten vierziger und fünfziger Jahren unbedingt verwiesen sehen wollte. Zwar hätte Greenberg wohl Schwierigkeiten mit Butzers krüppeligen ComicFiguren gehabt, doch was die Evokation von Materialität betrifft, wäre er hier voll auf seine Kosten gekommen. Dies nicht zuletzt deshalb, weil sich in Butzers Bildern eine klassisch-modernistische Trope materialisiert, die sich erstmals bei Matisse findet. Matisse wird schließlich der Ausspruch zugeschrieben, ein Kilo Grün sei grüner als ein halbes. [2] Auch Butzer operiert mit Farbhaufen, die die Materialität der Farbe qua Quantität behaupten und massiv auf ihr insistieren.Wenn also künstlerische Praktiken und kunstkritische Kategorien der fünfziger Jahre derzeit ein eigentümliches „Nachleben" entfalten und wenn diese Beobachtung mit der so. Ausgabe dieser Zeitschrift zusammenfällt, dann bietet es sich gleichsam an, beide Phänomene übereinander zu legen. Statt jedoch einfach die Gegebenheit dieser Dekade vorauszusetzen, wird ihr Anfang und ihr Ende als offen begriffen. Mit anderen Worten: Sie soll aus einer Perspektive der „Jetztzeit" (Walter Benjamin) in einer Weise konstruiert werden, die auch ein Licht auf die Gegenwart bzw. die in der Gegenwart anwesende Vergangenheit wirft. Nebenbei bemerkt: Gerade eine Zeit, die wie die fünfziger Jahre in weiter Ferne zu liegen scheint, kann sich bei näherer Betrachtung als aktueller als die unmittelbare Vergangenheit, etwa die derzeit omnipräsenten frühen achtziger Jahre erweisen. Jürgen Teipels viel diskutiertes Buch „Verschwende Deine Jugend" liefert ein Beispiel dafür, dass eine Subkultur, die (wenn auch aus einer Fülle verschiedener Quellen) über persönliche Erinnerungen rekonstruiert wird, mit ihren „harten Fronten" und Kämpfen plötzlich in ganz weite Ferne rückt.Um Missverständnissen vorzubeugen: Weder nostalgische Rückbesinnung noch bloße Verifikation eines ideologiekritischen Verdachts ist das, worauf es diese Ausgabe abgesehen hat. Die Zahl 50 ist vielmehr willkommener Anlass für die Auseinandersetzung mit einer Zeit, für die Anselm Haverkamps Begriff der „Latenzzeit" angemessen erscheint.Der Blick geht dabei zurück und nach vorn zugleich — nur ist es bei diesem „Jubiläum" nicht die eigene Geschichte der Zeitschrift, die im Mittelpunkt steht. In meiner Rolle als Herausgeberin fällt es mir prinzipiell schwer, zurückzublicken, die eigene Geschichte Revue passieren zu lassen oder gar Bilanz zu ziehen. Einmal abgesehen davon, dass dies bei der Fülle von Ausgaben, Themenschwerpunkten, Fragestellungen, Neuorientierungen, methodischen Wenden auch keine leichte Aufgabe wäre, hat es wohl mit einer Art professioneller Deformation zu tun, dass ich in Gedanken stets schon wieder beim nächsten Heft, der nächsten Fragestellung, dem nächsten Problem bin, dass die Aufmerksamkeit also grundsätzlich eher der Zukunft gilt. Solange dem so ist, solange bei mir und anderen — der Redaktion, den Mitarbeiter/innen und Autor/innen — die Überzeugung vorherrscht, dass es viel zu tun gibt, dass bestimmte Themen unbedingt behandelt werden müssen, so lange erscheint das rückblickende Bilanzieren keine vordringliche Aufgabe zu sein. (Editorial) Sprache: Deutsch/Englisch



































